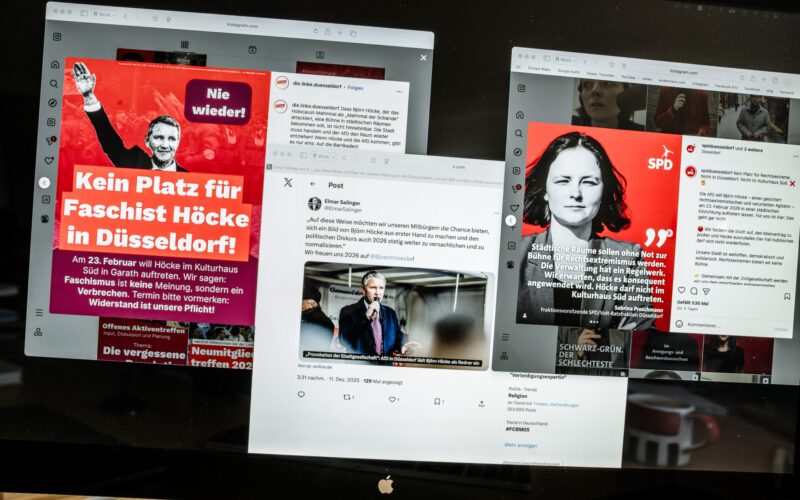Fünf Gründe für eine CO2-Uhr in Düsseldorf
Pablo Voss ist 17 Jahre alt, Mitglied des Düsseldorfer Jugendrats und besitzt eine sehr freundliche Art, über Dringlichkeit zu sprechen. Er hat in seinem Gremium einen Antrag eingebracht, der dort die volle Zustimmung erhielt und der inzwischen im Umweltausschuss und in der städtischen Klima-Kommission behandelt wird. Der Vorschlag: Am Rathaus wird dort, wo bisher die Schuldenfreiheits-Uhr hing, eine CO2-Uhr angebracht. Diese läuft rückwärts und zeigt, wie viel Zeit noch bleibt, bis das CO2-Budget verbraucht ist und infolgedessen die globale Erwärmung um 1,5 Grad steigt. Wir erklären die Idee und stellen die wichtigsten Argumente vor.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?