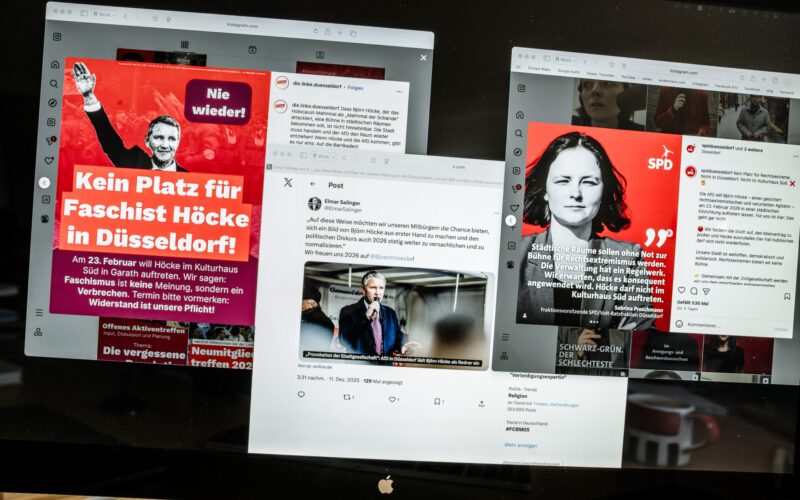Lütgenau, Resi und Horten – Erinnerungen an Düsseldorfer Passagen
Der folgende Text entstand für die Veranstaltung „Passagen reloaded“, die an Walter Benjamins großes Werk über Paris erinnert. Das Literaturbüro NRW hatte Ende Juli im Rahmen des Projekts EINE STRASSE zu einem literarisch-architektonischen Spaziergang entlang der Graf-Adolf-Straße eingeladen. Mit dabei waren der Stadtplaner Hans-Jürgen Greve, unser Autor Sebastian Brück und der folgende Text:
Samstagnachmittag. Der Graf-Adolf-Platz ist eine Straße, und wir stehen am Rande des Bürgersteigs. Vor uns: Stau auf der Abbiegespur. „Alle“ wollen zur Königsallee. An der anderen Straßenseite: das Hotel Leonardo Royal und das Kostüm-Fachgeschäft Deiters. Von hier aus werden wir in Opposition zu den üblichen Shoppingrouten die Graf-Adolf-Straße entlang spazieren – 850 Meter, Richtung Hauptbahnhof, inspiriert von Walter Benjamin. „Passagen Reloaded“.
Wir drehen uns um, betrachten die weite Fläche. Denn natürlich ist der Graf-Adolf-Platz auch ein Platz. 2006 hat die Stadt Düsseldorf diesem Ort ein neues Gesicht verpasst: Erhöhte Rasenflächen, durchzogen von linearen Durchgängen, dazwischen – Achtung, Beamtendeutsch – „alter und neuer Baumbestand“. Besonders fallen die Bänke ins Auge: weiße, längliche Objekte. Gemäß der Design-Idee liegen sie wie Mikado-Stäbe über dem Areal – wenn es dunkel wird, von innen beleuchtet.
„Nicht, dass du im Text einen auf rheinischen Benjamin machst“, sagt mein bester Freund P. „Das kann nur schiefgehen.“
„Ist klar“, sage ich. „Aber was es mit Benjamins Passagen auf sich hat, das muss man schon kurz erklären.“
Gesagt, getan: Der aus Berlin stammende Walter Benjamin – das ist der wohl berühmteste Flaneur aller Zeiten. Und sein zwischen 1927 und 1940 entstandenes Passagen-Werk – das ist sowohl ein philosophisches als auch ein literarisches Projekt. Im Titel nimmt es auf die überdachten Ladenpassagen Bezug, die ab dem frühen neunzehnten Jahrhundert in Paris entstanden.
P. zückt sein Smartphone und schaut mich bedeutungsvoll an. Und dann sagt er: „Lass uns doch einfach mit zwei Rezensionen starten, die zum Graf-Adolf-Platz abgegeben wurden – der besten und der schlechtesten.“
„Rezensionen?“ Ich runzele die Stirn, schaue ihn fragend an, da hat er bereits begonnen vorzulesen.
Die beste Google-Bewertung stammt von einem Daniel. Er gibt fünf Sterne und schreibt: Der Graf Adolf Platz (GAP) ist quasi die `grüne Insel´ am Anfang der Königsallee (Kö), die weltweit bekannt ist, auf der einen Seite – und dem architektonischen Leckerbissen GAP 15 auf der anderen.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?