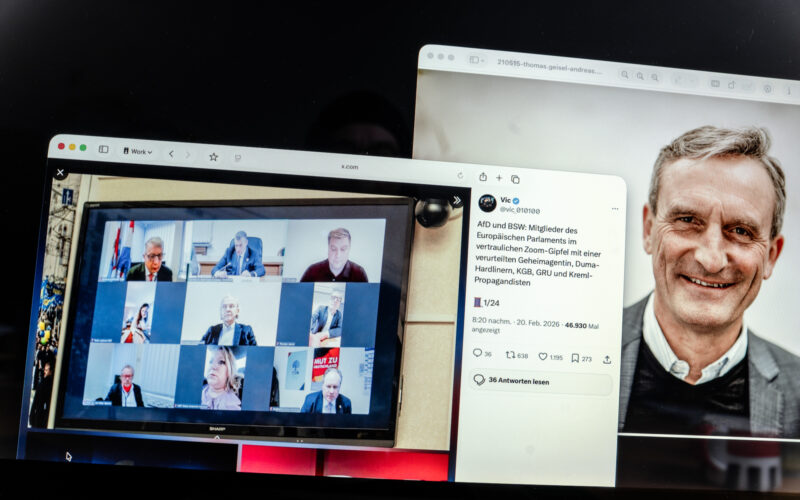Die Parshipisierung des Rheinufers
Vielleicht hat die Fremdscham meine Fantasie zu sehr angestachelt, aber ich fürchte, so könnte es wirklich gewesen sein: Ich war am frühen Samstagabend auf dem Rheindeich von Lörick nach Oberkassel unterwegs, als ich langsam zu einer jungen Frau und einem jungen Mann aufschloss, die sich merkwürdig unterhielten. Die beiden tauschten wohl gerade aus, was sie so beruflich machen. „Aber da musst Du doch voll die Ahnung von Computern haben“, sagt er erstaunt. „Ja“, sagt sie, erstaunt darüber, dass er erstaunt ist.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?