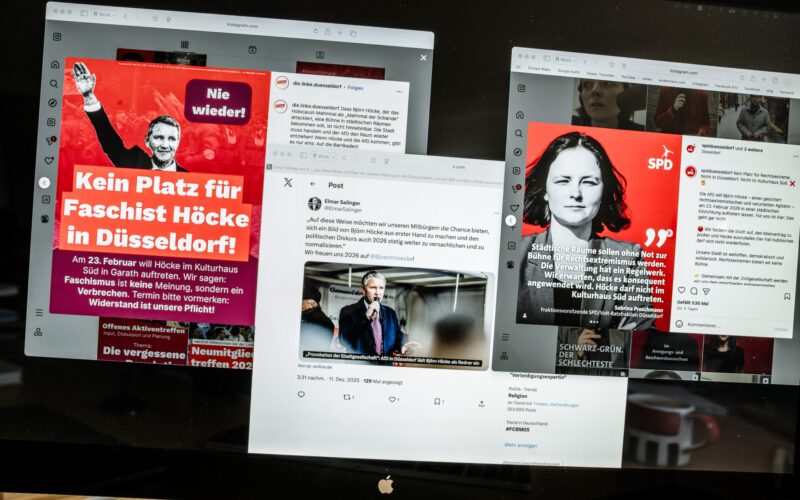Was sich im ersten Jahr mit Stephan Keller verändert hat

Am Anfang standen Geld und ein Fahrrad. Als Stephan Keller im November 2020 als Düsseldorfer Oberbürgermeister begann, war die erste Pressekonferenz eine gemeinsame mit Kämmerin Dorothée Schneider. Die beiden erläuterten die Lage des städtischen Haushalts und ihren Entwurf für 2021. Der Termin war ungeahnt sinnbildlich, denn Finanzfragen werden die Amtszeit Stephan Kellers wesentlich prägen. Düsseldorf nimmt corona-bedingt weniger Geld ein, deshalb wieder Schulden auf und möchte aber bis spätestens 2025 auf seinen alten Kurs zurückkehren.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?