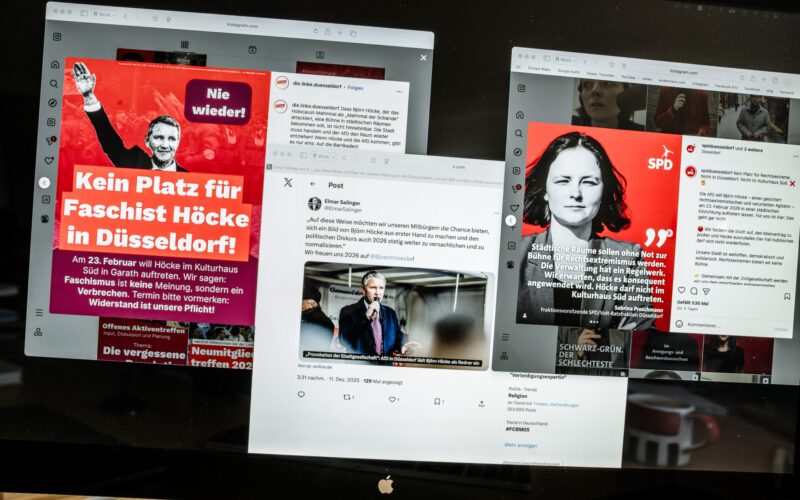Der Mann an der Seite von Stephan Keller wechselt womöglich den Arbeitsplatz

Olaf Wagner hebelt ein ungeschriebenes Gesetz des Düsseldorfer Stadtrats aus. Dort gilt: Wer vorne sitzt, ist wichtig, und je weiter hinten jemand man seinen Platz hat, desto kleiner ist dessen Rolle. Im politischen Teil des Saals belegen deshalb die Fraktionsvorsitzenden und wichtige Fach-Sprecher:innen die ersten Reihen. Ähnlich sieht es auf Verwaltungsseite, also in der so genannte Dezernentenbank aus: Vorne sitzen der Stadtdirektor und die Beigeordneten, dann folgen Referent:innen und einige Amtsleiter:innen. Nur für die dritte Reihe der Dezernentenbank gilt die Regel nicht, denn dort sitzt Olaf Wagner.
Er leitet das Büro von Oberbürgermeister Stephan Keller. Der Job war in den vorherigen 20 Jahren keiner, mit dem man sich auch nur ansatzweise beliebt machte. Er ähnelte der des Türstehers vor einer Disco, in die alle rein wollen. Die Leiter:innen des OB-Büros beraten den Rathaus-Chef, welche Termine er besuchen und mit wem er sich treffen sollte, für welche Themen er sich stark machen und wovon er sich weiträumig fern halten sollte. Ärger und Konflikte nehmen sie, soweit sie können, auf sich und halten sie von ihrem Vorgesetzten fern.
Die vorherigen OB-Büroleiter:innen (Christina Begale, Frank Scholz und Jochen Wirtz) haben diese vermeintliche unangenehme Aufgabe alle mit einer erstaunlichen Leidenschaft ausgeübt. Sie waren in Rathaus, Politik und Gesellschaft gefürchtet, das Bemühen, sich mit ihnen gutzustellen, war ein weit verbreiteter Extremsport. Folglich waren (und sind) sie regelmäßig auf wichtigen gesellschaftlichen Ereignissen als Gäste zu sehen.
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?