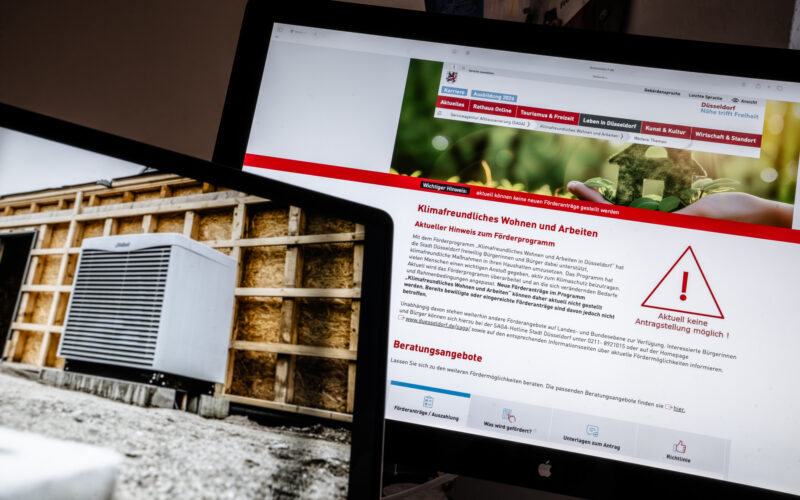Kö: Umbauten sollen Sevens und Stilwerk retten

Manchmal sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die eine – wenn auch versteckte – wichtige Botschaft enthalten: Eine der wichtigsten Adressen im Obergeschoss der Schadow Arkaden waren stets die Kundentoiletten. Nun gibt es sie nicht mehr. Ob für immer oder nur vorübergehend wurde nicht mitgeteilt. Die Türen sind verschlossen, die Piktogramme entfernt. Im benachbarten Eis-Café heißt es „Toilette? Ja, aber nur noch ganz unten.“ Gemeint ist das Tiefgeschoss mit seinen Gastronomiebetrieben. Dort findet der Kunde das, was er sucht, wenn er Erleichterung braucht. Kundenfreundlich ist das nicht, zumal es keinen Hinweis gibt. Weder im Erdgeschoss noch oben.
Das Einkaufszentrum, Anfang der 1990er Jahre von Architekt Walter Brune geplant und Mitte der 1990er eröffnet, verschob das Gewicht in der Düsseldorfer Innenstadt. Eine geschickte Anordnung der Laufwege und ein gut durchdachter Branchenmix lockte die Kundschaft an, in schwierigen Zeiten sahen die Eigentürmer (Rheinische Post Mediengruppe) im Objekt ihre Cashcow. Zumal das Parkhaus gut lief.
Aber nun hat man, wie die anderen Malls, Schwierigkeiten, Leerstände adäquat zu besetzen. Die obere Etage tut sich schwer, Leerstände gibt es aber auch unten: Seit Monaten sucht man mit großen Postern in den Fenstern des Ladenstrangs Richtung Schadowplatz neue Mieter. Die Flächen sind geschickt kaschiert, es ist nur schwer zu erkennen, wie viel vakant ist.
Sevens
Das ist jetzt eine gemeine Stelle, den Text auszublenden, das wissen wir.
Unser Journalismus ist werbefrei und unabhängig, deshalb können wir ihn nicht kostenlos anbieten. Sichern Sie sich unbegrenzten Zugang mit unserem Start-Abo: die ersten sechs Monate für insgesamt 1 Euro. Danach kostet das Abo 10 Euro monatlich. Es ist jederzeit kündbar. Alternativ können Sie unsere Artikel auch einzeln kaufen.
Schon Mitglied, Freundin/Freund oder Förderin/Förderer?