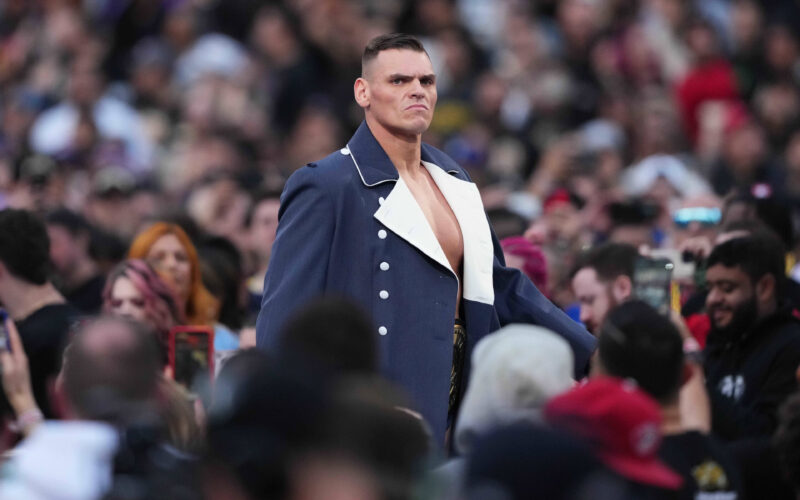Die unglaubliche Lebensgeschichte von Rosa Willinger

Seite 98 bis 100
Fazit
Eigentlich war man sich bisher weitgehend sicher, genau zu wissen, welche Facetten unsere Stadt nachhaltig charakterisieren und woher diese stammen. Die „Toten Hosen“ besangen 1983 die „Modestadt Düsseldorf“. Gelegentlich nennt man sie „Klein-Paris“. Immerhin ist das Frankreichfest seit 2001 eine der großen Sommerveranstaltungen, die weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Allerdings steckt auch einiges an geschickter Eigen-PR in dieser frankophilen Selbstzuschreibung. Was nicht weiter verwundert in Düsseldorf, der „Stadt der Werbeagenturen“, in der in den 1950er Jahren Vorläufer der großen Agenturen BBDO und Grey entstanden.
Viele dieser Zuschreibungen, wie Düsseldorf (angeblich oder tatsächlich) ist, stammen aus der Zeit der Bundesrepublik, sind vor wenigen Jahrzehnten entstanden und von Männern dominiert. Nun aber stellt sich heraus, dass es zumindest eine Person gab, die diese, uns heute so wichtigen Elemente des modernen Düsseldorfs schon vor über hundert Jahren verkörperte: modebewusst, frankophil, weltoffen, PR-affin, selbstbewusst. Diese Person stand bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts prototypisch für Eigenschaften und Werte, die wir heute so gerne mit unserer Heimatstadt verbinden. Das Besondere: diese Person war eine Frau aus dem Rheinland, sie war eine deutsche Jüdin – und sie wurde im Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet.
Die Willingers waren, laut der spärlichen Familienüberlieferung, keine besonders religiöse Familie. Unsere Untersuchung hat an vielen Stellen gezeigt, dass sie sich vor allem als jüdische Deutsche sahen, mit dieser Verteilung von leitendem Substantiv und begleitendem Adjektiv. Nicht zuletzt belegen dies die wenig jüdisch geprägten Namensgebungen und die Charakterisierung als „liberaal“ in der Kartei des Amsterdamer Judenrats. Zwar ließ man in der Familie die Jungen beschneiden – sogar noch Gerd/Gershon im Exil, obwohl dies 1942 für ihn, den die Eltern zu seiner Sicherheit kurz darauf an eine niederländische Familie weggaben, ein nicht unbeträchtliches Risiko darstellte. Auch dass Guidos erste, evangelische Frau mit der Hochzeit zum Judentum übertrat, deutet in diese Richtung. Aber man war eigentlich deutsch durch und durch. Selbst zum Christentum gab es keine zu großen Hürden: Kurt gab seinen Sohn, das einzige Kind, den Jesuiten, um seine Überlebenschancen in den besetzten Niederlanden zu erhöhen. (Samuels Bruder Wilhelm heiratete sogar zwei protestantische Christinnen nacheinander und willigte in die Taufe seiner beiden Kinder ein.)
Jüdische Deutsche zu sein, wurde aber für die Familie Willinger immer mehr zu einem Balanceakt – und ihnen dann gänzlich unmöglich gemacht. Deutschland, das Land, von dem die Familien Willinger und Meyer solange ein treuer Teil waren, wollte sie nicht mehr, vertrieb sie in die Niederlande – und ging dann noch weiter. Das Deutschland der Nationalsozialisten wollte sie tot sehen.
Dabei hatte insbesondere Rosa Willinger eine schier unglaubliche Lebensgeschichte – und diesem, ihrem Land sehr viel gegeben. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie in ihrem Leben immer wieder an Grenzen stieß und diese dann überwand. Sie kam vom Land, aus einer dörflich geprägten Umgebung, absolvierte eine Ausbildung zur Damenschneiderin, wurde eigenständig unternehmerisch tätig und etablierte sich in der Großstadt Düsseldorf in einem gutbürgerlichen Milieu (Uttermann, Gründgens). Schritt für Schritt emanzipierte sie sich von ihrem Mann, erkämpfte sich mehr und mehr Freiheiten und Eigenständigkeit. Sie machte sich unabhängig von den starren Rollenvorstellungen, wie eine Frau im Kaiserreich zu sein hatte und was sie alles eigentlich nicht tun durfte. Sie war eine Pionierin weiblichen Unternehmertums in den Zeiten des Wilhelminismus. In der Weimarer Republik etablierte sie sich und ihr Geschäft noch ein zweites Mal, erfand sich neu, diesmal als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern und Unternehmerin.
Der Zusammenhalt zwischen vielen Familienangehörigen war trotz aller Wirrungen, der vielen Umzüge und der Trennung der Eltern durchaus intensiv, insbesondere zwischen Rosa und ihren Söhnen Kurt und Guido. Selbst als diese erwachsen und verheiratet waren, lebte man zusammen: im Frankfurt der 1920er Jahre ebenso wie Anfang der 1930er Jahre in Duisburg; dann zwar teils in unterschiedlichen Wohnungen und mit kurzen Unterbrechungen, aber doch in derselben Stadt und nahe beieinander. Dasselbe gilt für den Anfang der 1940er Jahre im Amsterdamer Exil – jetzt allerdings unter nicht freiwillig gewählten Umständen.
Leider endete diese bewundernswerte Lebensgeschichte nicht gut. Die jüdische, deutsche Rheinländerin, die die Grenzen für Frauen in der Wirtschaftswelt des Kaiserreichs erheblich erweitert hatte, wurde das Opfer einer absolut entgrenzten Brutalität und Menschenverachtung. Ihr Raum zum Leben wurde durch die Nationalsozialisten immer mehr eingegrenzt: Sie musste aus Deutschland fliehen. Sie wurde in den besetzten Niederlanden bedrängt und interniert. Sie wurde von dort deportiert und im Vernichtungslager Sobibór ermordet.
Die vielen Morde, die diese jüdische Familie (wie so viele andere auch) erleiden musste, die unvorstellbaren Erlebnisse in den Lagern, auf der Flucht und im Untergrund versehrten auch die Überlebenden auf äußerst gravierende Weise. Die engen Familienbande der Willingers sind im und durch den Krieg weitgehend zerrissen worden. Auch die Menschen, die der unmittelbaren Gefahr entkommen konnten, waren für das Leben gezeichnet.
Die Cousins Gershon und Helmut fanden nie wirklich zueinander. Auch Gershons Kontakt zu seinen beiden Tanten war extrem lose. Margot traf Gershon nur ein einziges Mal, mit zehn Jahren. Sie besucht ihn bei seinen Pflegeeltern und brachte ein Kinderbuch für ihn mit. Allerdings gefiel ihm, der eigentlich eine Leseratte war, dieses Buch überhaupt nicht und er tauschte es in der lokalen Buchhandlung direkt gegen ein anderes um. Lag das nur daran, dass er das Buch nicht mochte, oder war dies eine (unter-)bewusste Reaktion auf die Teilnahmslosigkeit der Schenkenden am Leben des Beschenkten?
Zu Margots Tochter Regina entwickelten sich ebenfalls keine engeren Beziehungen. Erst zu Margots Enkelin Rosalie konnten – im neuen Jahrtausend – familiäre Verbindungen aufgebaut werden. Und Rosalie sagte über ihre Mutter und über ihre Großmutter: „They both should not have had children.“ Ein harscher Satz. Aber auch einer, der die psychologischen Verwerfungen spiegelt, die Margot und Regina in ihrem Leben erdulden mussten. Ohne die Jahre der Verfolgung, ohne die Jahre in Konzentrationslagern wäre sicherlich vieles anders und besser gewesen – und man hätte sich wohl auch des verwaisten (Groß-)Neffen angenommen.
Gershon traf seine Tante Gerda (für ihn bewusst) zum ersten Mal im Jahr 1988 – über vier Jahrzehnte nach Kriegsende. Er erinnert sich für seine Jugend lediglich an zwei Besuche ihres ersten Mannes. Der zweite Besuch erfolgte in Begleitung von Rita. Dies war 1951 – und es war ein Abschiedsbesuch. Beide Kinder von Guido Willinger waren Staatenlose, sodass Rita zunächst nicht mit Gerda, die sich ihrer annahm, in die USA reisen konnte. Sechs Jahre nach dem Krieg war es dann aber soweit: Josef Janowitz und Rita zogen zu seiner Frau Gerda in deren neue Heimat. Vor der Abreise in die USA besuchten die beiden noch Gershon bei seiner Pflegefamilie in Amsterdam. Er war damals neun Jahre alt und Rita war elf. Ab diesem Umzug war die Schwester für lange Zeit aus Gershons Umfeld verschwunden. Auch zu ihr entwickelte sich erst viele Jahrzehnte später eine engere Beziehung. Gershon bekannte: „Erst als ich 80 Jahre alt wurde, habe ich mir gedacht, dass ihr jetzt wirklich sagen sollte, dass ich sie liebe.“ So lange hatte es gedauert, bis eine gewisse Vertrautheit entstanden war.
Diese zerrütteten Familienverhältnisse zeigen, wie verheerend die Verfolgung und die sozialen Verwüstungen der Naziherrschaft selbst bzw. gerade in einer Familie von Nazi-Opfern, wie den Willingers, wüteten. Die Shoa ließ auch unter den Überlebenden viele Verheerungen zurück: Unverständnis, emotionale Sprachlosigkeit, innere Leere. Das, was die Nazis angerichtet hatten, wirkte sehr lange und sehr unheilvoll nach.
Rosa Willinger konnte ihren Familiensinn also nicht wirklich weitergeben. Auch ihre wirtschaftlich-sozialen Pioniertaten konnten keine dauerhaften Traditionslinien bilden. Ihre Lebensspuren waren komplett verweht. Als modebewusste, frankophile, weltoffene, PR-affine, selbstbewusste Unternehmerin scheiterte sie vor über einem Jahrhundert. Im Ersten Weltkrieg und dann (noch schrecklicher) im Dritten Reich setzte sich ein anderes Düsseldorf und ein anderes Deutschland durch: männlich dominiert, nationalistisch, militaristisch, antisemitisch. Am Ende kostete dieser Weg in die Barbarei Rosa Willinger, ihren drei Söhnen und zwei Schwiegertöchtern das Leben. Ihre Geschichte, ihre Lebensleistung gerieten komplett in Vergessenheit: so sehr, dass nicht einmal ihr einzig heute noch lebender Enkelsohn irgendetwas von ihren Pioniertaten wusste.
Umso wichtiger ist es, nicht nur für ihn, sondern für uns alle, diese neu entdeckten Vorläufer Spuren des heutigen, anderen Düsseldorfs sichtbar zu machen: Als ein kleines Zeichen, was wir alle durch die Nationalsozialisten verloren haben. Und als Dokumentation des Lebenswerks dieser mutigen Frau, die sich von keinen Grenzen einengen ließ – schon gar nicht von gesellschaftlichen Konventionen und dem, was „man“ zu tun hat.
Von Rosa Willinger ist doch etwas geblieben: vor allem ihre sechs Enkelkinder, neun Urenkelkinder, elf Ur-Urenkel und etliche Ur-Ur-Urenkelkinder, die der Ehe mit Samuel Willinger entstammen:
- Margot hatte eine Tochter Regina (Rosas ältestes Enkelkind), die wiederum eine Tochter hatte: Rosalie. Diese nach der Urgroßmutter benannte Israelin hat vier Töchter: Chava-Malka, Miriam, Shulamit und Zipora. Alle vier Ur-Urenkelinnen leben in Israel, sind orthodox orientiert und haben jeweils viele weitere Kinder.
- Kurts Sohn Helmut, Rosas ältester Enkelsohn, starb kinderlos.
- Guidos Tochter Rita hat zwei Kinder, Gidon und David. Diese beiden Urenkel von Rosa haben keine eigenen Kinder.
Guidos Sohn Gerd/Gershon hat zwei Töchter, Merav und Ayala, und einen Sohn: Boaz Yonatan. Diese drei Urenkelkinder von Rosa haben ihrerseits wieder Kinder, Rosas Ur-Urenkelkinder Hudson und Charlotte (von Merav), Hannah und Ellie (von Ayala) sowie Aliya, Eitan und Rachel (von Boaz Yonatan). - Gerdas ältere Tochter Vera heiratete einen Nicht-Juden und hatte zwei Töchter, Lisa und Julie, die sich nicht als jüdisch identifizieren (weitere Nachkommen sind nicht bekannt).
Gerdas jüngere Tochter Rosalie heiratete ebenfalls keinen Juden, aber lebt ein sekulär-jüdisches Leben und erzog ihren Sohn David, der keine Kinder hat, jüdisch.
Neben dieser großen Schar an Nachkommen ist von Rosa Willinger jetzt auch ihre eigene Geschichte geblieben: als jüdisch-deutsche Rheinländerin, als fünffache Mutter, als Pionierin weiblichen Unternehmertums. Wir hätten diese faszinierende Frau und ihre Familie sehr gerne persönlich kennengelernt. Wir freuen uns, dass sie für immer Teil unserer Schulgeschichte sein wird.


Seite 31 und 32
Als weibliche Unternehmerin war Rosa Willinger eindeutig eine Pionierin. Offenbar lag das in der Familie, denn ihre jüngere Schwester Hedwig (27.05.1881 – 21.05.1943) stand ihr darin kaum nach. Während in der Heiratsurkunde Hedwigs Mann David Bärmann als „Reisende[r]“ und „Sohn [eine]s Viehhändlers“ angegeben ist, firmiert Rosas Schwester als „Inhaberin eines Kostüm-Ateliers“, ist also ebenfalls eine im Textil-Sektor ökonomisch eigenständig agierende Unternehmerin – und dies sogar schon bei ihrer Hochzeit 1908! Rosas Schwester und Schwager wohnten seit 1909 in ihrem Wohn- und Geschäftshaus am Südwall 23 in Krefeld, also in unmittelbarer Bahnhofsnähe und sehr gut mit der K-Bahn aus Oberkassel erreichbar. Die beiden Schwestern, die nun wieder nahe beieinander, nur gut 20 km entfernt voneinander, wohnten, scheinen sich auch persönlich nahe gestanden zu haben; sogar so nahe, dass vier von Rosas Kindern vom Sommer 1916 bis zum Frühjahr 1918 in Krefeld bei Tante und Onkel gemeldet waren, also dort lebten (ggf. mit ihrer Mutter).
Hedwig war ihrer älteren Schwester mit ihren ökonomischen Aktivitäten zeitlich voraus: Als Rosa ihr Damenkonfektionsgeschäft 1912 in Düsseldorf eröffnete, bestand Hedwigs Geschäft bereits ein paar Jahre. Allerdings war Rosa noch eigenständiger unternehmerisch tätig als Hedwig, zumindest dokumentierte Rosa dies deutlicher nach außen hin. Hedwigs Geschäft firmierte zwar als „Meyers Modesalon“ – und damit unter ihrem Mädchennamen. Allerdings sind diese Angaben in den Krefelder Adressbüchern immer nur als Anhängsel hinter dem Namen ihres Mannes und der „Firma Baermann David“ zu finden – und nicht als eigenständiger und alleiniger Eintrag, wie bei Rosa Willingers „Louvre“. Der Ehemann, David Bärmann, wird ganz offen als „Inh[aber]“ bezeichnet. Diese Angaben finden sich in den jährlich erschienenen „Adreßbüchern der Stadt Heiratsurkunde David Bärmann – Hedwig Meyer, 10.08.1908 (Nr. 588/1908 Krefeld-Mitte, Stadtarchiv Krefeld). Auch in den „Krefelder Adressbüchern“ der 1920er Jahre, als Frauen das Wahlrecht erhalten hatten, sind die Einträge nur in Ansätzen gleichberechtigt: Hedwig wird nun als „Kauffrau“ eigenständig geführt, aber „Meyers Mode-Salon“ firmiert nach wie vor unter dem Namen „David Baermann“.
Das Geschäft scheint floriert zu haben: Anders als die Willingers hatten die Bärmanns schon vor dem (und nicht erst im) Weltkrieg einen Telefonanschluss in ihrem Laden. Zudem überlebte „Meyers Modesalon“ den Ersten Weltkrieg, anders als das „Louvre“. Das Geschäftshaus war bzw. ist durchaus repräsentativ; es liegt am recht eleganten Südwall, der mit seinem baumbestandenen Mittelstreifen wie ein Boulevard wirkt. Im Erdgeschoss befand sich das Modegeschäft, die Familie wohnte darüber, ob im 1. und/oder 2. Stock ist nicht zu ermitteln. Das Haus gehörte, zumindest vor dem Weltkrieg, C. Hügel, der im Nachbarhaus, Südwall 25, wohnte und eine „Strickgarn- und Weingroßhandlung“ betrieb.
Das Wohn- und Geschäftshaus war in jedem Fall groß genug, um Besuch aus Oberkassel zu empfangen. Hedwig und David Bärmann wohnten und arbeiteten dort, laut ihrer Meldekarte seit dem 08.05.1909. Zuvor hatten sie am Alexanderplatz 3 gewohnt. Die Ehe blieb kinderlos. Selbst wochen- und monatelange Besuche der Willlinger-Nichten und -Neffen waren, vielleicht auch deshalb, sehr willkommen und sind für die Jahre 1916- 1918 und für 1920 (Margot und Gerda) nachweisbar.
Seite 61 und 62
Welche Rolle spielte die harte wirtschaftliche Realität während des immer schlimmer werdenden Ersten Weltkriegs bei diesen turbulenten Familienereignissen? Wenige Schritte von dem Geschäft entfernt, in dem Rosa Willinger Damenkleidung mit internationalem Flair anbot, errichtete man Anfang 1916 am Graf-Adolf-Platz eine überlebensgroße hölzerne Löwenfigur als „Kriegswahrzeichen“, in die die Bevölkerung gegen eine Spende Eisen- und Bronzenägel einschlagen konnte. Auf diese Weise kam bis Januar 1917 die Summe von 800.000 Mark zum Durchhalten im Krieg gegen Frankreich, England und Russland zusammen. Scheiterte das ehemalige „Louvre“ an diesem Umfeld, an der vorherrschenden nationalistischen Haltung im wilhelminischen Weltkrieg? Zerbrach auch die Ehe daran, dass die ungewöhnlich eigenständige Geschäftstätigkeit der Mutter nicht von den Zeitereignissen begünstigt war, dass ein Damenkonfektionsgeschäft mit französischem Namen nicht mehr in das Umfeld der Kö im Weltkrieg passte? Oder an den Erlebnissen, die Samuel aus einem etwaigen Einsatz von der Front mit nach Hause brachte? Scheiterte Rosas Geschäft an den gesellschaftlichen und politischen Grenzen, die im späten Kaiserreich vorherrschten?
Auf diese Fragen wird es keine definitiven Antworten im Detail mehr geben können. Aber auch wenn wir Einzelheiten nicht mehr herausfinden werden, so ist das große Bild doch eindeutig. Die zeitliche Parallele war kein Zufall: Das gemeinsame, augenscheinlich harmonische Familienleben mit vier Erwachsenen und fünf Kindern im komfortablen Haus an der Oberkasseler Leostraße im Jahr 1916 endete praktisch zur selben Zeit wie Rosa Willingers Damenkonfektionsgeschäft um die Ecke von der Königsallee – und auch das eheliche Zusammenleben von Rosa und Samuel bestand spätestens nach 1918 nicht mehr.
Nach den knapp zwei Jahren in Krefeld wurden die vier jüngeren Kinder zum 21.02. (bzw. im Fall von Kurt zum 11.03.) 1918 zwar wieder in Düsseldorf angemeldet, an die Adresse Schwanenmarkt 20, an der seit 1917 Rosa, Samuel und Ismar gemeldet waren. Dies bedeutete jedoch nicht den Beginn einer neuen gemeinschaftlichen Phase der Familie. Vielmehr wurde 1918 dann das ganz große Umbruchjahr. Im Herbst, parallel zum Untergang des Kaiserreichs, fiel auch die Familie endgültig auseinander: Die Eltern Samuel und Rosa zogen getrennt voneinander aus Düsseldorf fort und nach Duisburg. Am 03.10.1918 meldete sich Rosa in die dortige Steinsche Gasse 4 ab und nahm laut Meldekarten auch die beiden Mädchen sowie Ismar mit – wahrscheinlich auch den zehnjährigen Guido. Am 12.12.1918 erfolgte auch die Abmeldung von Samuel nach Duisburg, die genaue Zieladresse ist unbekannt. Dieser Schritt könnte auch mit einer Entlassung aus dem Militärdienst zu tun haben, da in diesen Wochen das deutsche Heer demobilisiert wurde. Offenbar trennten sich die Eltern spätestens zu dieser Zeit: Alle weiteren Meldeeinträge ab dem Dezember 1918 wurden nur für Samuel und nicht mehr, wie bisher, für ihn und Rosa gemeinsam vorgenommen. Die Ehe der Willingers wurde dann mit Urteil des Landgerichts Frankfurt vom 16.04.1921 geschieden. Getrennte Wege gingen sie aber schon zweieinhalb Jahre zuvor.
Das Buch
Markus Bußmann/Sabrina Blaschke/AG „Jüdische Schüler des Comenius-Gymnasiums 1908-45“: Die unglaubliche Lebensgeschichte von Rosa Willinger, Edition Virgines, 29,90 Euro